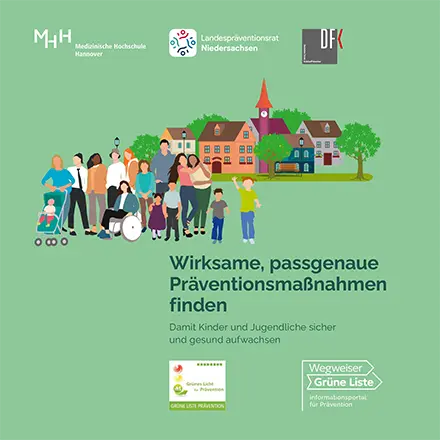Erklär-Video:
Info-Broschüre:
e:due:du - Eltern und Du (früher: OPSTAPJE). Ein Familienbildungsprogramm.
Effektivität nachgewiesen
Programminformationen
Altersgerechte Entwicklungsförderung von Kindern durch gezielte Anleitung von Eltern sowie Stärkung elterlicher Kompetenzen für einen erfolgreichen Bildungsverlauf:
- ganzheitliche Entwicklungsförderung von Kindern in den Bereichen Sprache, Sensomotorik, physische und psychische Gesundheit, Wahrnehmung und Motorik, sowie kognitive und sozio-emotionale Fähigkeiten.
- qualitative und quantitative Verbesserung der Eltern-Kind-Interaktionen (Stärkung der Eltern-Kind-Bindung)
- Sensibilisierung der Eltern für die altersgerechten Bedürfnisse ihrer Kinder und für einen einfühlsamen Umgang mit ihnen
- Wissensvermittlung zu Entwicklung und Erziehung und anderen relevanten Themen
- Stärkung der Erziehungskompetenzen und Eigenverantwortung der Eltern („Empowerment“: Nutzung, Erweiterung und Stärkung familiärer Ressourcen)
- Aufhebung von sozialer Isolation und Integration der Familien in das soziale Umfeld sowie Anbindung an weitere Angebote
Alle Mütter und Väter mit Kindern im Alter ab der Geburt bis zu Einschulung, die zusätzlichen Unterstützungsbedarf haben bei der positiven Begleitung der Entwicklung des Kindes sowie bei der Wahrnehmung kindlicher Bedürfnisse und bei der feinfühligen Reaktion auf die Bedürfnisse des Kindes.
Das Programm findet im Wesentlichen bei den Familien zu Hause statt. Durch die Hausbesuche (1x pro Woche, je 45-60 Min.) wird eine Alltagsnähe hergestellt, so dass Veränderungen von Verhaltensmustern im Kontext des Familienalltags stattfinden können. Dadurch werden Transferverluste vermieden und entwicklungsförderliche Interaktionen zwischen Eltern und Kindern gefördert.
Die Teilnahme am Programm kann zwischen 6 Monaten bis 6 Jahre betragen, in der Regel meist 12 bis 24 Monate. Die Umsetzung erfolgt durch geschulte Laienfachkräfte („Familienbesucherin/ Familienbesucher“), die häufig einen ähnlichen kulturellen Hintergrund haben wie die Zielgruppe. Die Laienfachkräfte werden durch sozialpädagogische Fachkräfte angeleitet und unterstützt, sowie zu relevanten Inhalten geschult.
Interaktion stellt das zentrale Element der Methode dar: gemeinsames, spielerisches Lernen von Mutter bzw. Vater und Kind steht im Vordergrund. Außerdem gehört die Erhöhung des Anregungsgehaltes in der häuslichen Umgebung und die Bereitstellung pädagogisch wertvoller Materialien zur Methode, um die Entwicklung der Kinder im kognitiven, motorischen, sozialen und emotionalen Bereich zu fördern. Die Familienbesucherin/ der Familienbesucher hat eine Vorbild-Funktion für ein Modellernen in Alltagssituationen. Positive Reaktionen des Kindes auf das Verhalten des Familienbesuchenden wirken als stellvertretende Belohnungen und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass die Eltern dieses Verhalten in ihr eigenes Repertoire übernehmen.
Im 1. Programmjahr von e:du eht es um Lernen am Modell: Das Kind spielt mit der Familienbesucherin/ dem Familienbesucher, die Eltern schauen zu und können fragen. Der
Arbeitsschwerpunkt der Laienfachkraft liegt neben dem Aufbau einer Vertrauensbasis auf der Initiierung des gewünschten Verhaltens.
Im 2. Programmjahr von e:du steht die Verstärkung im Zentrum: Das Kind und die Mutter bzw. der Vater spielen miteinander. Die Familienbesucherin/der Familienbesucher leitet an und gibt bei Bedarf Hinweise und Unterstützung, beantwortet Fragen, verstärkt erwünschtes Verhalten. Das bereits erworbene Verhaltensrepertoire wird ausdifferenziert und gefestigt, die Eigenverantwortung der Mütter bzw. Väter für die Förderung ihrer Kinder wird stärker in den Vordergrund gerückt.
Darüber hinaus sieht e:du ab der 10. Programmwoche ein von der professionellen Koordinatorin oder Koordinator geleitetes Gruppentreffen der Eltern (möglichst mit Kinderbetreuung) zusätzlich zum Hausbesuch vor. Die Gruppentreffen finden alle 2-8 Wochen (für jeweils 2 Std.) in zentralen Räumen im Stadtteil statt. Diese Gruppentreffen sollen Wissen über Entwicklung und Erziehung von Kleinkindern vermitteln, den Aufbau eines sozialen Netzwerkes der teilnehmenden Familien unterstützen und die Motivation der Teilnehmenden aufrechterhalten. Es sollen Ressourcen aktiviert und erweitert werden und die soziale Isolation durch neue Kontakte und der Erfahrungsaustausch bzw. die Anregung zur gegenseitigen Unterstützung aufgehoben werden. Die Gruppentreffen bieten die Möglichkeit, Diskussionen über Schwerpunktthemen in Erziehung und Familienalltag zu führen sowie die einzelnen Programmaktivitäten zu üben und zu vertiefen. Das Programm e:du bietet den Eltern auch das Kennenlernen weiterer Angebote für Familien und Kinder im Stadtviertel. Die Gruppentreffen haben einen informellen Teil (gemeinsames Frühstück, Austausch über Alltagsprobleme und Alltagserlebnisse) und einen formellen Teil (Demonstration einer neuen Spielaktivität und/oder Information und Diskussion über ein für die kindliche Entwicklung relevantes, von den Teilnehmenden oder der Koordinatorin bzw. des Koordinators vorgeschlagenes Thema).
Die Schulungen für Familienbesucherinnen und -besucher werden von den Programmanbietenden in der Regel alle 2 Monate angeboten, die Schulungen für die Koordinatorinnen und Koordinatoren alle 3 Monate (beides online). Wenn ein Standort mehrere Personen schulen lassen möchte, ist eine Inhouse-Schulung auf Anfrage auch möglich. Die Austauschtreffen für Laienfachkräfte und Koordinierende finden kostenfrei im 3-Monats-Rhythmus statt (online).
Programmweiterentwicklung:
Das ursprüngliche Programm e:du (0-3 Jahre) wurde um weitere 6 Bausteine ergänzt und kann somit die Familien mit Kindern von 0 bis 6 Jahren begleiten. Die Weiterentwicklung des Programms wurde von der Universität Bremen wissenschaftlich begleitet.
Häufig handelt es sich bei den teilnehmenden Familien um sozio-ökonomisch benachteiligte Familien, die andere Angebote der klassischen Familienbildung oder Erziehungshilfe eher selten wahrnehmen. Mögliche Gründe dafür können strukturelle soziale Benachteiligung wie Armut, Arbeitslosigkeit oder ungünstige Wohnverhältnisse sein, aber auch Konflikte, Trennung/Scheidung, Alleinerziehen oder Überforderung, chronische Erkrankungen und andere psychosoziale Probleme. Alternativ können auch andere Bezugspersonen, z.B. Großeltern, Tanten/Onkel, am Programm teilnehmen, wenn es für die Eltern nicht möglich ist.
Die geschulten Laienfachkräfte sind häufig Frauen ohne eine pädagogische Vorbildung, die das Programm meist selbst mit ihren Kindern durchlaufen haben, und einen ähnlichen Hintergrund haben wie die teilnehmenden Familien.
Die professionellen pädagogische Fachkräfte besitzen Kenntnisse in frühkindlicher Entwicklung. Sie sind zuständig für fachliche Vernetzung, die Leitung der Gruppentreffen und Vorbereitung der Laienfachkräfte.
Die Familienbesucherin/der Familienbesucher bringt entwicklungspsychologisch wertvolle Spielmaterialien (z.B. programmeigene Bilderbücher und Aktivitätskarten) oder nutzt vorhandene Materialien aus dem Haushalt. Alle Spielmaterialien verbleiben in der Familie.
Die Kosten zum Programm sind hier aufgeführt:e:du_Kostenaufstellung.pdf
weiteres Material:
Sann, A., Thrum, K. (2005). Opstapje - Schritt für Schritt. Ein präventives Spiel- und Lernprogramm für Kleinkinder aus sozial benachteiligten Familien und ihre Eltern. Praxisleitfaden. München: Deutsches Jugendinstitut.
Manstetten, A., Sann, A., Thrum, K. (2004). Schritt für Schritt - Opstapje:Flyer - Schritt für Schritt. Vorstellung des Modellprogramms und der wissenschaftlichen Begleitung. Kurzfassung. München: Deutsches Jugendinstitut.
Aue, M., Thrum, K. (2003). Schritt für Schritt - Opstapje. Video zum präventiven Frühförderprogramm für zweijährige Kinder sozial benachteiligter Familien. Nürnberg; München: Medienwerkstatt Franken.
Sann, A., Thrum, K. (2002). Guter Start mit Opstapje. Frühförderung für Kinder aus sozial benachteiligten Familien. DJI Bulletin, 60/61, 3-5.
Aumühlweg 3,
2544 Leobersdorf
Sann, A., Thrum, K. (2005). Opstapje - Schritt für Schritt. Abschlussbericht des Modellprojekts. München: Deutsches Jugendinstitut.
Programmbewertung
Kriterien sind erfüllt.
Sann & Thrum 2005:
Quasi-experimentelles Untersuchungsdesign mit Prä-Post-Messungen und 9 Monaten Follow-up mit Vergleichsgruppe. Zur Interventionsgruppe gehörten 72 Familien (weitere 12 brachen ab) und zur Vergleichsgruppe 20 Familien, die untervergleichbaren Lebensbedingungen Kinder erziehen. Kinder, die am Opstapje-Programm teilnahmen, haben deutlichere Fortschritte in der Entwicklung gemacht als Kinder in der Vergleichsgruppe. Darüber hinaus hat sich ein Abbau von psychischen Belastungen der Eltern ergeben.
Kornreuther 2021:
Die Evaluation ist eine Qualitätssicherungsstudie (ohne Kontrollgruppe, ohne Beweiskraft) und bezieht sich auf die Anwendung der drei Familienbildungsprogramme Willkommen mit IMPULS, HIPPY und Opstapje bei geflüchteten Familien in Deutschland im Zeitraum von 2015-2018. Angewendet wurden quantitative Methoden (Analyse von Teilnehmendendaten und eine Online-Befragung von Standorten der Programme) sowie qualitative Methoden (Interviews und teilnehmende Beobachtungen mit geflüchteten Familien). Die drei Programme wurden überwiegend gemeinsam ausgewertet. Ergebnisse, die direkt Opstapje zugeordnet werden konnten, waren: 1) die Anzahl der teilnehmenden geflüchteten Familien an Opstapje und Opstapje Baby hat sich von 2015 zu 2018 gesteigert, 2) der Zugang zu Opstapje erfolgte vor allem über private Netzwerke und mündliche Empfehlungen und/oder über Verweise von anderen Einrichtungen (jeweils über 80%), während Flyer (38%) und Internet (9%) eine deutlich geringere Rolle spielten, 3) Anregungen für Opstapje waren: mehrsprachige Informations- und Lernmaterialien/Bücher/Internetseiten erstellen, wohnortnähere Räume für Gruppentreffen, weitere Hausbesucherinnen/Hausbesucher mit Sprachhintergrund der Familien anwerben, Schulung der Hausbesucherinnen/Hausbesucher verbessern, Personalschlüssel erhöhen, weitere Finanzierung.
Diese Evaluation entspricht Stufe 1 in der Grünen Liste Prävention. Für die Einstufung des Programms wird die Studie mit dem aussagekräftigsten Design zugrunde gelegt, daher basiert die Einstufung von e:du (früher Opstapje) auf der Evaluation von Sann & Thrum 2005.
Programmumsetzung
Vor Ort anerkannte/r Trägerin oder Träger der Jugendhilfe oder ein Wohlfahrtsverband.
Suchzugänge
Familie
Probleme mit dem FamilienmanagementNachbarschaft / Stadtteil
wenig Bindung in der NachbarschaftSchule
Lernrückstände schon seit der GrundschuleFamilie
Bindung zur Familie Gelegenheiten zur pro-sozialen Mitwirkung Anerkennung für die pro-soziale MitwirkungKinder / Jugendliche
Soziale KompetenzenDas Programm wurde am 24.05.2011 in die Datenbank eingestellt
und zuletzt am 15.10.2025 geändert.