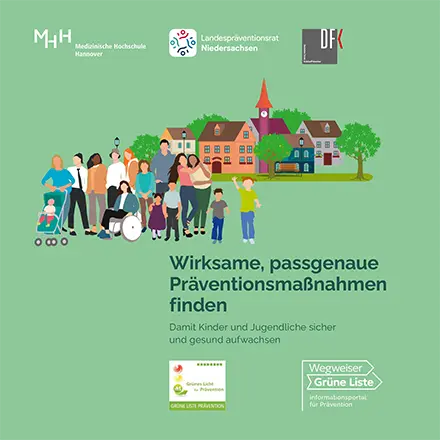Programmsuche
Freitextsuche
Schnellsuche nach Risiko- und Schutzfaktoren
Familie
- Geschichte des Problemverhaltens in der Familie
- Probleme mit dem Familienmanagement
- Konflikte in der Familie
- zustimmende Haltung der Eltern zum Problemverhalten: Alkohol- und Drogenkonsum
- zustimmende Haltung der Eltern zum Problemverhalten: antisoziales Verhalten
Schule
- frühes und anhaltendes antisoziales Verhalten
- Lernrückstände schon seit der Grundschule
- fehlende Bindung zur Schule
Kinder / Jugendliche
- Entfremdung und Auflehnung
- früher Beginn des Problemverhaltens: antisoziales Verhalten
- früher Beginn des Problemverhaltens: Alkohol- und Drogenkonsum
- zustimmende Haltungen zum Problemverhalten: Alkohol- und Drogenkonsum
- zustimmende Haltungen zum Problemverhalten: antisoziales Verhalten
- Umgang mit Freunden mit Problemverhalten: Alkohol- und Drogenkonsum
- Umgang mit Freunden mit Problemverhalten: antisoziales Verhalten
- Anerkennung von Peers für Problemverhalten
- anlagebedingte Faktoren
Nachbarschaft / Stadtteil
Familie
- Bindung zur Familie
- Gelegenheiten zur pro-sozialen Mitwirkung
- Anerkennung für die pro-soziale Mitwirkung
Schule
Kinder / Jugendliche
- Moralische Überzeugungen und klare Normen
- Soziale Kompetenzen
- Religion
- Interaktion mit pro-sozialen Peers
Nachbarschaft / Stadtteil
gemerkte Programme
Erklär-Video:
Info-Broschüre:
Information
Es wurden keine passenden Datensätze gefunden.